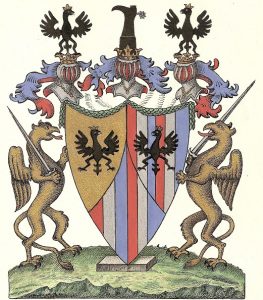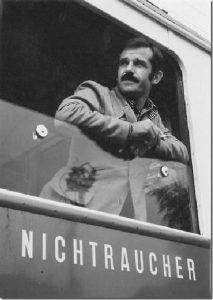Fällt ihnen liebe Leserin, lieber Leser bei diesem Titel ein düsteres Kellergeschoss ein, in dem ein paar obskur gekleidete Männer vor einer kochenden Brühe sitzen? Tiefstes dunkles Mittelalter? Die Kerle versuchen, aus Blei Gold zu machen. Alchemie hat einen Anstrich von Okkultismus.
Immerhin, alle grosse Kulturen, die Ägypter, die Chinesen, die Araber, die Juden, die Griechen und auch die Christen betrieben antike Chemie. Sie alle versuchten herauszufinden, was die Welt in Innersten zusammenhält.
Viele Metalle kommen in der Natur gediegen, elementar, rein und in ungebundener Form vor. Besonders geeignet, fanden die Alchemisten, seien Blei, Quecksilber und Gold. Sie liessen sich wegen ihres tiefen Schmelzpunktes einfach über einem Holzfeuer verflüssigen. Blei war der Favorit bei diesen Untersuchungen. Tagelang wurde es gekocht. Als es wieder erstarrt war, befand sich unten im Schmelztiegel etwas Gold. «Ich kann aus Blei Gold machen. Ich muss das Blei nur lange genug in der Hitze flüssig halten», ging es dem Priester durch den Kopf. In Europa waren die meisten Alchemisten katholische Patres und pröbelten hinter verschlossenen Türen des Klosters. Es ging den Klerikern nicht in erster Linie um die Herstellung von Gold. Sie wollten ihre Kenntnisse der Heilmittel, der Kräuter und Blumen erweitern. Die Techniken der Alchemie sollten ihnen helfen, ein viel grösseres Ziel zu erreichen: das Universalheilmittel. Eine Medizin, die alle Krankheiten für immer heilt. Bei diesen Versuchen der Transformation stiessen auch sie auf Gold.
Was geschah wirklich bei dieser Bleikocherei? Was die Mönche nicht wussten, gediegenes Blei war nie ganz rein. Ein winziger Teil war Goldstaub. Beim Erhitzen von Blei gingen beide Metalle in die flüssige Form über. Gold ist spezifisch schwerer als Blei und sank somit auf den Boden des Tiegels. Den Alchemisten war es gelungen, Blei zu reinigen. Reines Blei und reines Gold lagen getrennt vor. Von einer Umwandlung von Blei in Gold konnte keine Rede sein. In ihrer Zeit sahen die Experimentatoren das anders. Lange wurde Blei wochenlang ohne Unterbruch weiter gekocht.
Dann verwandelte sich das Weltbild.
Die Kirchenspaltung, die Theorie des heliozentrischen Weltbilds machten die Runde. Die Erde war nicht mehr der Mittelpunkt allen Geschehens. Ein seit Jahrtausenden geltender alter Glaube zerbrach. Die Aufklärung, die Renaissance, das 18. und 19. Jahrhundert veränderte die Gesellschaft von Grund auf. Kopernikus, Newton und Kant läuteten eine neue Zeit ein. Das theoretische Wissen der Natur des Mittelalters wurde total neu geschrieben, durch eine naturwissenschaftliche Revolution ersetzt. Die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Staatsführung, die Kunst und die Kultur erlebten einen Umwandlungsprozess. Warum sollte in dieser Sozietät nicht auch Blei zu Gold gemacht werden können?
Die Menschen lernten Schreiben und Rechnen. Heute ist es kaum verständlich, wie gross der Widerstand der gebildeten Elite gegen die Strömungen der Moderne war. Im Gymnasium wurde immer noch Altgriechisch und Latein studiert. An den Universitäten gab es neben der Philosophie nur noch drei weitere Fakultäten, Theologie, Medizin und Jurisprudenz.
Die Naturwissenschaften fristeten ein Schattendasein innerhalb der Philosophie. Sie blieben ein Betätigungsfeld von privaten neugierigen Einzelgängern. Lavoisier, ein Experimentator der ersten Stunde, musste sich bei seinen Arbeiten privat finanzieren. In dieser liberalen Welt nahm die Zahl der Forscher und der Erfindungen zu. Der Okkultismus der Alchemisten, der Stein der Weisen, die Herstellung von Gold, der Glaube an Wunder wurden von der neuen Generation von Forschern als suspekt abgewiesen. Sie begannen zu beobachten, zu experimentieren. Die Versuche mussten sich wiederholen lassen. Aus ihnen wurden Naturgesetze abgeleitet. So kam es zu brauchbaren Erfindungen. Das Handwerk der Physiker und Chemiker hatte das Tasten im ungewissen Dunkeln der Alchemie abgelöst. Industrien waren im Kommen.
Ganz unbrauchbar war der Nachlass der Alchemie nicht. Sie hatten ihr Wissen im «Grossen Werk» im «Opus magnum» hinterlassen. Für nicht Eingeweihte ein unentwirrbares Gemisch von unterschiedlichsten Anweisungen und Erfahrungen. Unlesbar.
Carl Gustav Jung, der Mitbegründer der Psychoanalyse, unternahm die Herkulesarbeit, das Wissen des Opus magnum herauszuschälen. Bei dieser Arbeit tauchte er immer tiefer in die Essenz der Welt der Alchemisten ein. Jung erkannte einen inneren Zusammenhang zwischen dem, was er erforschte und dem Ziel, hinter dem die Alchemisten her waren. Im Grunde waren die Träume und die Visionen, die diese Tüftler im Mittelalter hatten, genau die gleichen, welche seine Patienten hatten. Das war die Erkenntnis eines grossen Genies.
Jung begann, sein alchemisches Wissen für seine tiefenpsychologische Arbeit anzuwenden. Bei seiner Arbeit in seiner Praxis brachten seine mittelalterlichen Kenntnisse therapeutischen Erfolg. Er publizierte seine Erfahrungen am Ende des 20. Jahrhunderts.
Da stellt sich die Frage, gibt es heute noch Menschen mit einer alchemische Vita? Menschen, die mit ihren Ideen im Dunkeln tappen. Menschen, die instinktiv nach dem Unmöglichen suchen. Gibt es heute moderne Alchemisten?
Sind es jene, die wissen wollen, was vor dem Urknall war? Sind es jene, die mehr über das Leben auf dem Planeten wissen möchten? Sind es die Adepten von Albert Einstein, die sich mit der Raumzeit und den Higgs Teilchen herumschlagen? Oder sind es namenlose Unbekannte, die nach der Suche von Fremdem ihren Weg suchen?
Ein interessanter Gedanke, finden Sie nicht auch, liebe Leserin, lieber Leser? Geben Sie mir weitere 200 Jahre, dann sehen wir weiter.
Views: 67