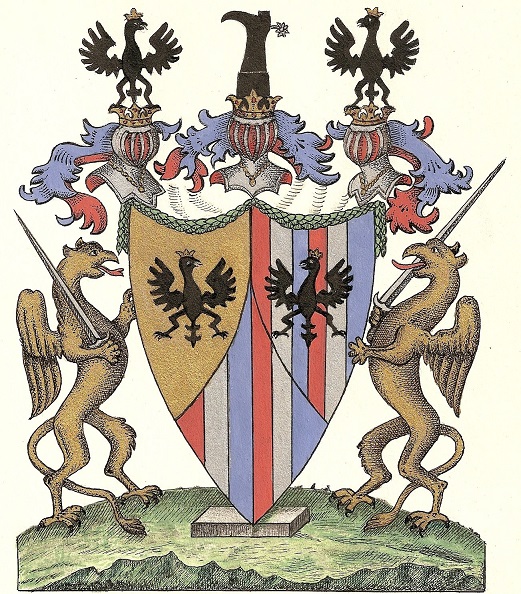L’été 1947 fut un été d’exception. Pas une goutte de pluie jusqu’à la mi-septembre. En juillet de cette année-là, Henricus, Antonius „Han“ van Meegeren (1887-1947) fut jugé à Amsterdam. Il était architecte, peintre, restaurateur et artiste-peintre. Han ne comptait pas parmi les peintres les plus notables de son époque. Au contraire, il est considéré comme le faussaire d’art le plus génial du 20e siècle. Personne ne le savait avant son procès. Il était accusé d’avoir fait des affaires en tant que collaborateur avec les nazis et en tant que vendeur de biens artistiques nationaux des Pays-Bas. La Couronne avait ainsi subi des pertes pécuniaires. Il avait vendu le tableau de Vermeer „Le Christ et la femme adultère“ au criminel de guerre et homme politique national-socialiste de premier plan Hermann Göring, pour 1,7 million de florins. Un trafic d’œuvres d’art spoliées et interdit. Il risquait une lourde peine de réclusion. Pour sauver sa peau, il avait fait des aveux incroyables au tribunal.
„Le tableau qui est entre les mains de Göring n’est pas, comme vous le supposez, un Vermeer van Delft, mais un van Meegeren! C’est moi-même qui ai peint ce tableau!“ Il avait ainsi certes vendu un faux, mais pas un bien culturel. L’accusation de collaboration fut ainsi abandonnée. Le procès fut suspendu. Le procureur ouvrit immédiatement après une nouvelle plainte pour fraude et contrefaçon. Han van Meegeren se retrouva à nouveau devant les juges. Il fut condamné à un an de prison ferme. Les autorités de poursuite pénale ne purent exécuter la peine. Han préféra mourir d’une défaillance cardiaque juste avant l’expiration du délai d’appel.
Je n’aurais jamais entendu parler de cette affaire – j’étais alors un élève du canton de Lucerne âgé de quatorze ans – s’il n’y avait pas eu la célèbre galerie d’art Fischer, située près de l’Église de la Cour, dans la Haldenstrasse. De nombreux et précieux originaux d’arts plastiques y étaient négociés. À l’époque, un tableau prestigieux de Jan Vermeer van Delft (1632-1675) y était exhibé. Vermeer est l’un des peintres hollandais les plus connus de l’époque baroque. Il travaillait à l’époque de l’Âge d’Or des Pays-Bas.
Au cours de sa carrière de contrefacteur, l’accusé avait jeté sur le marché de nombreux tableaux de peintres importants de cette période et en avait tiré de bons profits. „Les Joueurs de cartes“, le Vermeer qui était accroché dans la galerie de Fischer, figurait également sur la liste des délits de contrefaçons du procès. Cette nouvelle venant d’Amsterdam fit l’effet d’une bombe à Lucerne. Une catastrophe pour la galerie commerçante de Fischer. D’un seul coup, le fleuron de l’entreprise ne valait plus que quelques kopecks. Mais pour la ville des lumières, c’était la meilleure publicité touristique. Lucerne, soudain devint le centre de commerce international de l’art. Elle n’avait pas à se soucier des gros titres.
Je suis né à La Haye à l’époque de la fondation du parti national-socialiste. J’ai personnellement fait l’expérience d’une grande partie de ce régime de terreur aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette croustillante histoire de mon pays natal éveilla mon intérêt. J’ai donc commencé à étudier tout ce qui avait été publié à ce sujet. J’éprouvais même une certaine sympathie pour ce rusé escroc. À mes yeux, il n’était pas seulement un bon peintre, mais il avait aussi réussi à tromper toute la guilde des experts en art pendant des décennies. En étudiant ces rapports, une question revenait sans cesse. Aujourd’hui encore, je n’ai pas de réponse à cette question.
Supposons que nous ayons dans notre salon un tableau du 17e siècle. Évidemment pas une de ces célèbres œuvres qui sont reproduites dans tous les livres d’histoire de l’art. Un beau tableau de 40 x 21 cm. Une vue de la ville de Delft de la main de Pieter de Hoog (1629-1684). Une des œuvres peu connues de ce célèbre maître. Un travail de qualité possédant un fort rayonnement. Un tableau qui, lorsqu’on le regardait à nouveau attentivement de plus près, dévoilait des choses nouvelles, pas encore discernées. L’horloge sur le clocher de l’église. Le soldat de garde devant la porte de la ville. Ou la fumée nébuleuse d’une cheminée lointaine. Une image qui plaît. Un tableau qui communique silencieusement avec celui qui le regarde.
Puis, comme par enchantement, tombant de nulle part, la mauvaise nouvelle. C’est un faux de van Meegeren. Ce n’est pas du tout un de Hoog! Nous ne possédons pas d’original de Pieter de Hoog. Le tableau serait-il d’un coup devenu moins expressif ? Aurait-il égaré son âme ? Simplement parce qu’il a perdu de sa valeur marchande? Cela reste une belle peinture à l’huile, réalisée par un peintre, faussaire certes, mais bon. Pendant longtemps, elle nous a procuré beaucoup de plaisir à la contempler. Les arts figuratifs sont-ils une question d’argent ou d’art?
De temps en temps, j’ai encore de la peine pour Vincent van Gogh. De son vivant, il pouvait à peine vivre de son art. Il y a quelques mois, un tableau de lui a changé de mains pour 35 millions de dollars chez Christies à New York. Il s’agissait d’un tableau d’ambiance d’Arles (F) „Meules de blé“ peint à l’aquarelle sur papier. Vincent n’a pas pu vendre son tableau à l’époque. Aujourd’hui, quelqu’un la paie à un prix qui permettrait d’acheter une entreprise industrielle de taille moyenne.
Le témoignage d’une œuvre d’art se trouve-t-il amélioré parce qu’elle se vend chaque année plus chère que lors des actions internationales précédentes, qu’elle prend de la valeur ? Bien sûr, je sais aujourd’hui qu’il existe un marché de l’art où l’offre et la demande ont cours. Il ne faudrait pas qu’on y découvrit une œuvre de contrefaçon. Il ne s’agit là que d’argent, mais de beaucoup d’argent. Il y a quelque chose qui cloche.
Ce qui compte, c’est le plaisir qu’éprouve un spectateur lorsqu’il est conquis par un tableau. Si un Van Meegeren se présente en Vermeer et que le spectateur est captivé, alors l’art n’est plus que de l’art. Le tableau a alors atteint son but. Il n’y a pas de prix pour cette finalité!
Views: 65